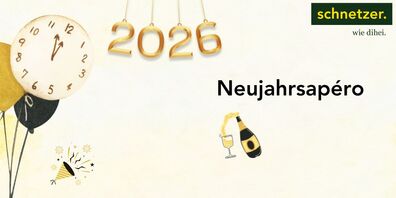Das neue Konzept der Frühen Förderung aus Herisau, das sich bis Ende Oktober 2025 in der Vernehmlassung befindet, richtet sich an Kinder bis fünf Jahre. Vorgesehen sind unter anderem Hausbesuche, da sich gezeigt habe, dass schriftliche Informationen nicht genügen würden. Der persönliche Austausch mit den Eltern solle sicherstellen, dass sie auf bestehende Angebote aufmerksam werden und ihre Erziehungsverantwortung wahrnehmen.
Helen Alder, Gossauer Stadträtin (Departement Jugend Alter Soziales), und Cornelia Kunz, Wiler Stadträtin (Departement Gesellschaft und Sicherheit), haben unsere Fragen beantwortet.
In Herisau sollen Hausbesuche Teil der Frühen Förderung werden. Was halten Sie von dieser Idee?
Helen Alder: Ich kenne das Konzept nicht im Detail. Flächendeckende Haubesuche sind in Gossau aber kein Thema. Wir setzen darauf, dass die Eltern die bestehenden Angebote nutzen. In diesem Alter werden die Kinder primär vom Kinderarzt und der Mütter- und Väterberatung begleitet und es gibt einen Elterntreff. Wenn sie ins Spielgruppenalter kommen, werden die Eltern auf weitere Angebote ausdrücklich hingewiesen und aufgefordert, diese zu nutzen. Mit den bestehenden Angeboten werden fast alle Familien erreicht.
Cornelia Kunz: Aufsuchende und zielgruppenspezifische Angebote sind ein wichtiges Instrument in der Frühen Förderung, weshalb auch der Kanton St.Gallen eine entsprechende Handlungsempfehlung an die Gemeinden abgegeben hat.
Könnten Sie sich vorstellen, ein solches Modell auch in Gossau beziehungsweise Wil einzuführen?
Helen Alder: Es gibt bereits verschiedene Angebote, welche mit Hausbesuchen verbunden sind. Die Familien werden nach der Geburt meist von Hebammen betreut, welche Hausbesuche machen. Danach meldet sich die Mütter- und Väterberatung bei den Eltern. Auch diese bietet Hausbesuche an. Mit PAT (Parents as Teachers) haben wir eine weitere Möglichkeit, die Eltern zu Hause zu unterstützen. Schlussendlich erfolgt auch die Sozialpädagogische Familienbegleitung zu Hause.
Cornelia Kunz: Im «Konzept frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung der Stadt Wil», welches im Juni 2017 vom Parlament verabschiedet wurde, wird dieses Angebot für die Stadt Wil ebenfalls aufgegriffen. In den vergangenen Jahren hat sich die Stadt Wil auf den Aufbau der Spielgruppen sowie die Entwicklung des Familienzentrums konzentriert. Nebst diesen Angeboten verfügt die Stadt Wil im aufsuchenden Bereich seit vielen Jahren eine Jugend- und Familienbegleitung, welche bei einem bereits bekannten Bedarf Kinder und deren Familien betreut. Auch die Mütter- und Väterberatung bietet Beratungen bei den Familien zu Hause an.
Welche Chancen sehen Sie darin – und wo könnten Schwierigkeiten oder Grenzen liegen?
Helen Alder: Grundsätzlich ist es auch bei uns ein Ziel, dass die Eltern gut informiert sind und die Angebote kennen. Die meisten Eltern sind selber in der Lage, sich Unterstützung zu holen, wenn dies überhaupt erforderlich ist. Mit Elternbildungskalender und Elternbildungsanlässen für Kleinkinder werden möglichst viele Eltern erreicht. Flächendeckende Hausbesuche erscheinen unter diesem Aspekt nicht notwendig. Es fragt sich auch, ob hier Kosten und Nutzen in einem sinnvollen Verhältnis stehen. Ich stelle mir vor, dass viele Eltern solche Besuche irritieren würden.
Cornelia Kunz: Die heute oftmals genannte familienzentrierte Vernetzung ist ein wirksames Modell im Bereich der Frühen Förderung. Hier ist die Familienbegleitung, neben dem Netzwerkmanagement, eine zentrale Komponente. Diese wird häufig als aufsuchendes Angebot gestaltet.
Die Herausforderungen bei aufsuchenden Angeboten entstehen aus der Abdeckung, welche damit erreicht werden soll. Eine flächendeckende Umsetzung ist mit erheblichem Ressourcenaufwand verbunden, welcher kaum finanzierbar ist. Bei einer selektiven Umsetzung besteht die Gefahr, dass ein Teil der gewünschten Zielgruppe nicht erfasst wird und damit die Wirksamkeit eingeschränkt ist. Aus diesen Gründen hat sich die Stadt Wil bisher auf das Spielgruppenangebot und das Familienzentrum konzentriert.